Diversität als symbolisches Feigenblatt: Zwischen falschen Versprechen und institutioneller Realität
von Hannah Lutat
Bevor ich als Beraterin für diversitätässensible Organisationsentwicklung arbeitete, schrieb ich in einer Phase der Arbeitslosigkeit frustriert die 36. Bewerbung. Zum 36. Mal stolperte ich dabei über Sätze wie: „Vielfalt wird als Bestandteil unserer Organisationskultur verstanden, mit dem Anspruch, diese auch in der Zusammensetzung unseres Personals abzubilden. Deswegen freuen wir uns besonders über Bewerbungen von Frauen mit Migrationshintergrund.“ Nun ist es eben so, dass ich eine Frau bin, die statistisch als Person mit „Migrationshintergrund“ geführt wird- eines meiner Elternteile ist nicht in Deutschland geboren. Ich selber bevorzuge die Selbstbezeichnung Person mit Migrationserbe, geboren mit dem Privileg des white-passing (ich werde als weiß gelesen), das in weißen Kontexten immer ungefragt mit “ach das sieht man dir ja gar nicht an!“ kommentiert wird, in zweiter Generation akademisiert, ich habe keine sichtbare Behinderung. Wieso sich eine potenziell zukünftige Arbeitgeberin ausdrücklich aufgrund dieser Bausteine meiner Identität auf eine Bewerbung von mir freuen würde, löst bei mir innere Widerständen aus. Vorherrschend der Gedanke, dass es mehr braucht als einen wohlplatzierten Satz in einer Stellenausschreibung, um mich als ökonomisch verwertbare Zielgruppe ernsthaft für sich zu gewinnen.
Warum solche Sätze verwendet werden, ist offensichtlich: Sie fungieren als Codes, die Diversität als normativen Wert und institutionelle Selbstverpflichtung markieren und zeigen sollen, dass identitätspolitische Diskurse im eigenen Haus zumindest rhetorisch verortet sind. Gerne wird diese Selbstzuschreibung visuell durch Regenbogen-Flaggen oder kommunikativ durch Unternehmensprofile unterstrichen, in denen Schlagworte wie „respektvolles Miteinander“ oder „Vielfalt“ selbstbewusst nach außen proklamiert werden. Problematisch ist dabei allerdings, dass diese Bekenntnisse häufig nicht mit einer kritischen Auseinandersetzung der internen Strukturen einhergehen, wodurch tatsächliche Ausschlussmechanismen im Inneren unberührt bleiben. Codes wie diese lassen sich in einem normativen Diversitätsverständnis verorten, das Chancengleichheit, Offenheit und Vielfalt beschwört, ohne die ihnen zugrunde liegenden strukturellen Machtverhältnisse und Diskriminierungsmechanismen konsequent offenzulegen. Während Diversität dabei als moralischer Wert erscheint, bleiben konkrete Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Kontrollmechanismen weitgehend unbenannt. Dies legt nahe, dass diese Strategien häufig nicht über eine symbolische Ebene hinausgeht, gruppenfokussiert ist und intersektionale Benachteiligungen nur implizit adressieren. In der Summe wird dadurch ein entpolitisiertes Diversitätsnarrativ reproduziert, das bestehende Ausschlüsse und Ungleichheiten eher verwaltet als sie aktiv zu transformieren. Ein solches Verständnis von Diversität droht dann zum symbolischen Feigenblatt zu werden und primär auf der Ebene von perceived safety zu operieren: Sie erzeugen den Eindruck von Zugehörigkeit und Schutz, ohne die materiellen und organisatorischen Voraussetzungen eines tatsächlichen Safer Spaces herzustellen. Anstatt Betroffenenperspektiven als analytischen Ausgangspunkt für strukturelle Veränderung ernst zu nehmen, werden Sicherheitsbedürfnisse kommunikativ adressiert und scheinbar befriedigt. Die Verantwortung wird damit subtil auf die Wahrnehmung der Betroffenen verschoben, während institutionelle Machtverhältnisse, Ausschlussmechanismen und fehlende Schutzstrukturen unangetastet bleiben.
Wie verletzend eine solches System sein kann, wird in Arbeitskontexten oft verkannt, weil ein Bewusstsein darüber fehlt, dass organisationale Routinen, Entscheidungswege und Kommunikationskulturen nach einer weißen, hetereotnormativen, nicht-behinderten Logik funktionieren, in der fehlende Sichtbarkeit, informelle Ausschlüsse, unklare Zuständigkeiten, oder schlicht das Gefühl, nicht „mitgedacht“ zu werden inhärent sind. Und diese Logiken tuen weh, weil sie Anerkennung simulieren, ohne Schutz zu bieten und Sichtbarkeit versprechen ohne strukturelle Konsequenzen nach sich zu ziehen. Sie greifen biografische Verletzbarkeiten zwar auf, bleiben jedoch lediglich in einem leeren Versprechen von Zugehörigkeit hängen und lassen Betroffene letztendlich mit der Verantwortung für ihre eigene Sicherheit alleine. Die Verletzung liegt dabei weniger in der offenen Exklusion als in der diskreten Erfahrung, adressiert zu werden, ohne gemeint zu sein und in der stillen Enttäuschung darüber, dass das Versprechen folgenlos bleibt. Für viele meiner Kolleg:innen sind eigene Diskriminierungs- und Marginalisierungserfahrungen mitunter der zentrale Motor, im Feld der Diversitätssensiblen Organisationsentwicklung tätig zu werden. Die Motivation fußt oft auf Erfahrungswissen, das sich aus Erfahrungen von Statusverlust, Prekarität und eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten speist. Etwa den erschwerten Zugang zu Beschäftigung, beruflichem Aufstieg oder fehlender institutioneller Anerkennung. Die langfristigen Auswirkungen davon prägen individuelle wie kollektive Biografien. Vor diesem Hintergrund verstehe ich Diversitätssensible Organisationsentwicklung als einen Ansatz, der darauf abzielt, Arbeitsstrukturen so zu verändern, dass strukturelle Ungleichheiten adressiert werden, die bislang häufig unter dem neoliberalen Konstrukt der „Chancengleichheit“ unberührt blieben. Wenn ich von diversitätssensibler Organisationsentwicklung spreche, dann spreche ich davon eine Arbeitskultur zu gestalten, die geprägt ist von demokratischer Teilhabe und Bedürfnisorientierung, von Zuhören, von Sehen und Gesehenwerden, von Mitgefühl und Haltung, von Lernbereitschaft, Fehlerfreundlichkeit und Selbstreflexion, von Neugier und Entdeckungslust und der Offenheit, sich auf etwas Neues, mir vielleicht Unbekanntes, einzulassen. Von dem Mut Routinen und alte Denkmuster aufzubrechen und neue Räume, Abläufe oder Mechanismen zu etablieren, die Wohlbefinden und Sicherheit für ALLE garantieren. Aber auch davon Kontrolle abzugeben, Hierarchien und Machtansprüche nicht mehr als gegeben hinzunehmen sondern kritisch zu hinterfragen, Hürden abzubauen, kreative Lösungen finden, Verantwortungen zu teilen und ein Bewusstsein für Lebensrealitäten außerhalb meiner Comfort-Zone zu entwickeln. Dafür braucht es Empathie und Vertrauen in sich selbst und in das Kollektiv und keine leeren Worthülsen.
Hannah Lutat hat Philosophie, Politik und Sozialwissenschaften in Berlin, Venedig und Bremen studiert. Sie ist Beraterin, Referentin und Trainerin für Rassismuskritik & Empowerment.
Copyright: Hannah Lutat
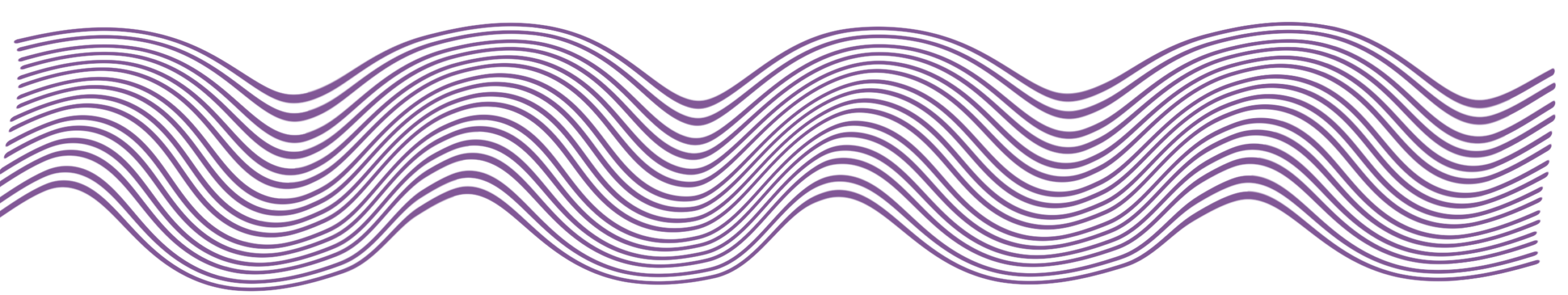

Das Online-Dossier

