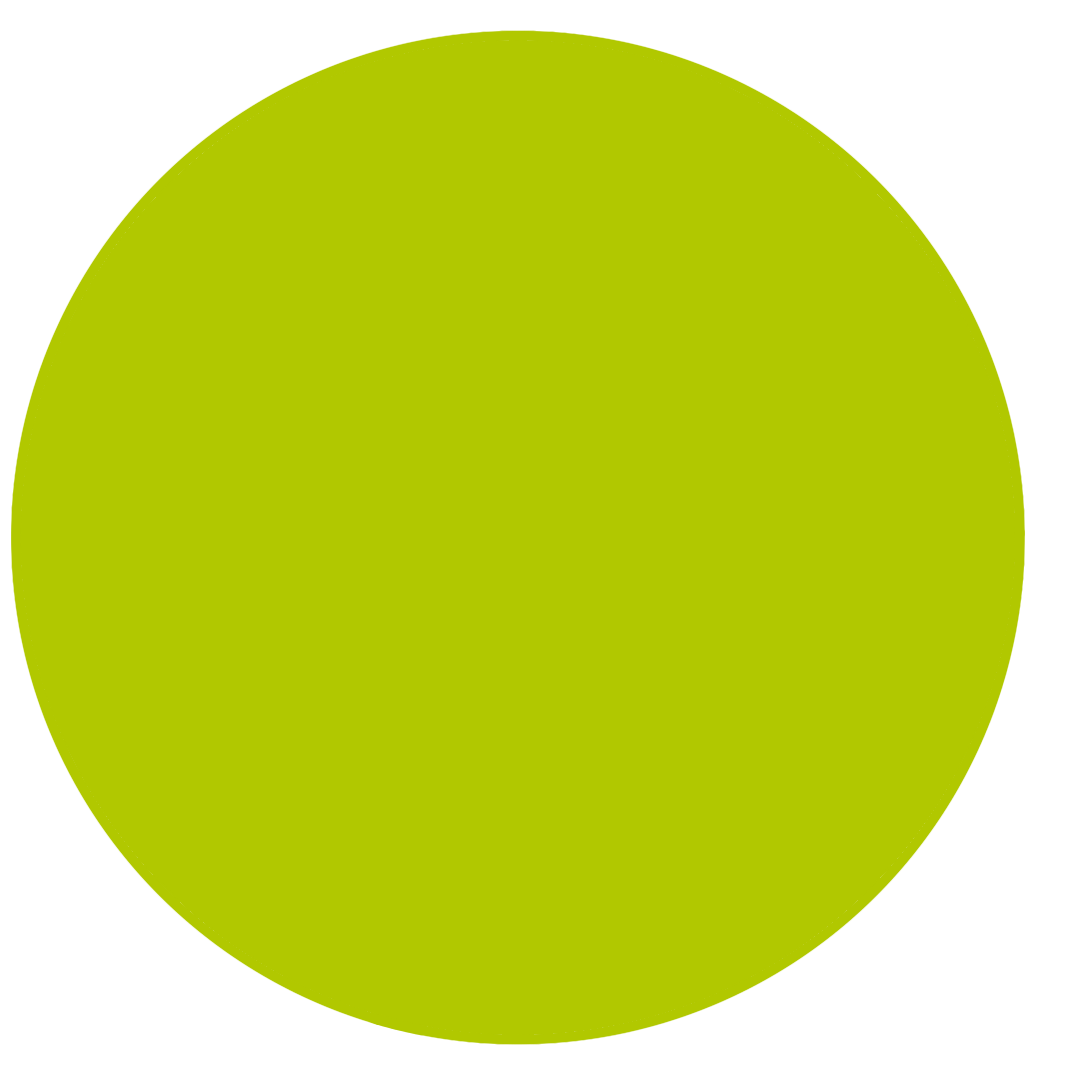Schutz statt Schuld: Sexismus und Antifeminismus in der Gleichstellungsarbeit
von Amelie Henze
In Workshops zum Thema Antifeminismus zeigt sich immer wieder, dass Sexismus präsent ist, Antifeminismus jedoch oft unscharf bleibt. Dabei ist diese Unterscheidung zentral: Nur wenn wir benennen können, was uns widerfährt, lassen sich auch die dahinterliegenden Macht- und Abwertungsstrategien erkennen. Sexismus begegnet vielen Frauen und TIN*-Personen (trans*, inter*, nicht-binären Personen) alltäglich – und er ist keineswegs „nicht so schlimm“. Er bildet zugleich eine zentrale Grundlage antifeministischer Ideologien und Mobilisierungen. Sexismus wirkt strukturell, verschränkt sich mit weiteren Diskriminierungsformen wie Queerfeindlichkeit oder Rassismus und bildet die Grundlage für andere Gewaltformen. Er zeigt sich nicht nur in Kommentaren oder Witzen, sondern in ungleichen Machtverhältnissen, Ausschlüssen und realen Gefährdungen.
Gleichstellungsarbeit als Angriffspunkt
Gleichstellungsarbeit setzt genau an diesen Strukturen an. Sie macht Ungleichheiten sichtbar, entwickelt Gegenstrategien und stellt bestehende Machtverhältnisse infrage. Genau deshalb gerät sie ins Visier antifeministischer Angriffe.
Antifeminismus richtet sich nicht nur gegen einzelne Maßnahmen, sondern gegen die grundlegende Idee von Gleichstellung. Er leugnet strukturelle Ungleichheiten, naturalisiert Geschlechterhierarchien und verteidigt traditionelle Rollen- und Familienbilder. Queere Lebensweisen werden dabei als Abweichung markiert und angegriffen. Diese Dynamiken wirken politisch und strukturell – und sie wirken auch auf die Menschen, die Gleichstellung vertreten.
Gleichstellungsbeauftragte arbeiten gegen strukturellen Sexismus und sind ihm gleichzeitig selbst ausgesetzt. Für Frauen und TIN*-Personen in der Gleichstellungsarbeit bedeutet das eine strukturelle Doppelrolle, deren Belastung häufig unterschätzt wird und die sich direkt auf das eigene Wohlergehen auswirken kann.
Sexismus ist eine Diskriminierungsform, die die Mehrheit der Frauen und TIN*-Personen im Arbeitskontext erlebt. Hinzu kommen antifeministische Anfeindungen, die sich gezielt gegen Gleichstellungsarbeit und die Personen richten, die sie ausüben. Gleichstellungsarbeit wird delegitimiert, lächerlich gemacht oder als ideologisch diffamiert. Die Angriffe können strukturell wie persönlich erfolgen, etwa durch sexistische und queerfeindliche Aussagen oder Anfeindungen im Arbeitsalltag. Erfahrungsberichte aus Workshops zeigen, dass viele Gleichstellungsbeauftragte eine Zunahme solcher Angriffe wahrnehmen.
Diese Dynamik betrift jedoch nicht nur formale Gleichstellungsfunktionen. Gleichstellung ist in Verwaltung und Kommunalpolitik institutioneller Auftrag. Damit entsteht für viele eine doppelte Belastung: die Arbeit gegen strukturellen Sexismus bei gleichzeitiger eigener Betrofenheit von sexistischen und antifeministischen Anfeindungen.
Was dabei oft übersehen wird: Diese Erfahrungen wirken im Körper. Studien zeigen, dass chronischer Stress durch Sexismus langfristige psychische und körperliche Auswirkungen haben kann. Doch besonders der unmittelbare Moment bleibt häufig unsichtbar.
Ich habe selbst Workshops gegeben und besucht, in denen es darum geht, wie wir Sexismus und Antifeminismus begegnen können. Dort werden hilfreiche Strategien vermittelt – etwa schlagfertige Antworten zu üben, nonverbale Signale zu setzen, Situationen zu verlassen oder ein klares Stopp zu formulieren – und es ist absolut valide, sich mehr Handlungsmacht zu wünschen. Gleichzeitig ist es wichtig, über eine mögliche Verantwortungsverschiebung zu sprechen – wenn Empowerment ungewollt zur Erwartung wird. Denn was passiert, wenn uns diese Handlungsfähigkeit in der konkreten Situation nicht zur Verfügung steht?
Betroffene erzählen von Situationen, in denen ein sexistischer Spruch fällt, ein queerfeindlicher Witz erzählt wird oder ihre Grenze überschritten wird – und sie lächeln. Oder sie sagen nichts. Erst später kommen Gefühle wie Wut, Verletzung oder Scham. Vielleicht auch Selbstvorwürfe: Warum habe ich nichts gesagt?
Eine mögliche Antwort auf diese Fragen findet sich in dem Buch „Körper lügen nicht – Trauma und Transformation in der Welt und in uns selbst“ von Staci K. Haines (2024), das eine körperorientierte Perspektive auf Schutzreaktionen eröffnet.
Unser Nervensystem verfügt über angeborene Schutzmechanismen, die bei Bedrohung automatisch aktiviert werden. Diese Reaktionen sind nicht bewusst steuerbar. Zu diesen Schutzmechanismen zählen Kämpfen, Fliehen, Erstarren, Unterwerfen und Dissoziieren. Gleichzeitig sind sie sozial und gesellschaftlich geprägt – auch durch Geschlecht, Machtverhältnisse und erlernte Erwartungen daran, wie wir uns „verhalten sollen“.
Gerade in solchen Situationen zeigen sich bestimmte Schutzreaktionen immer wieder. Drei davon möchte ich im Folgenden genauer betrachten.
Erstarren ist der Impuls, still zu werden und zu warten, bis die Gefahr sich abwendet. Sprache und Bewegung können blockiert sein, von Atem anhalten bis zu tatsächlichem Sprach- und Handlungsverlust.
Unterwerfen kann bedeutet, sich kleiner zu machen, zu lächeln, zu beschwichtigen oder zuzustimmen, um Gefahr abzuwenden. Diese Reaktion kann kurzfristig Sicherheit herstellen, jedoch im Nachhinein mit Schuld- und Schamgefühlen einhergehen. Auch, weil gesellschaftlich häufig die Verantwortung für Grenzsetzungen und Gegenwehr bei den Betroffenen selbst verortet wird.
Dissoziieren kann sich sehr unterschiedlich zeigen. Wenn wir dissoziieren, schützen wir uns, indem wir uns innerlich aus der Situation zurückziehen, um nicht vollständig erleben zu müssen, was gerade passiert. Das kann unterschwellig geschehen: der Blick kurz leer, wir treiben geistig ab oder schrumpfen innerlich zusammen. Auch späteres lückenhaftes Erinnern oder das erst nachträgliche Spüren von Verletzung können auftreten. Auch hier gilt: Nicht-Reagieren ist eine Reaktion – ein Schutz vor Überforderung (vgl. Staci K. Haines 2024: 148ff).
Empowerment bedeutet deshalb nicht, immer schlagfertig oder handlungsfähig zu sein. Es kann auch bedeuten, die eigenen Reaktionen besser zu verstehen und zugleich den Blick auf strukturelle Bedingungen und Täter*innen zu richten.
Für viele Menschen kann es stärkend sein, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, sich zu verbünden und Erfahrungen zu teilen. Auch körperorientierte Zugänge können helfen, wieder mehr Sicherheit im eigenen Körper zu entwickeln. Über Sexismus und Antifeminismus in der Gleichstellungsarbeit zu sprechen, heißt auch, ihre Wirkung auf Menschen ernst zu nehmen – und solidarische Bedingungen zu schaffen.
Amelie Henze (sie) ist Bildungsreferentin für Workshopgestaltung, Vielfalt und Queerfeminismus.
Copyright: Amelie Henze
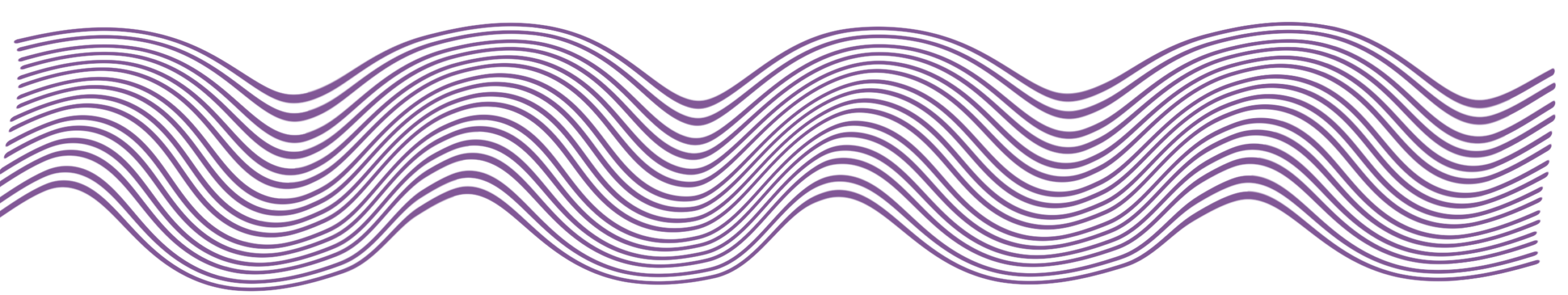

Das Online-Dossier
Dieser Text ist Teil des Online-Dossiers “Gemeinsam stark!” Hier schreiben Expertinnen aus der Bildungspraxis über die Themen der Qualifizierungsreihe und geben einen Ein- und Ausblick in ihre Arbeitsfelder: Resilienz und Selbstfürsorge, Female Empowerment, Organisationen diverser aufstellen, Sexismus in der Gleichstellungsarbeit in Niedersachsen. Hier geht es zu allen Texten: Online-Dossier